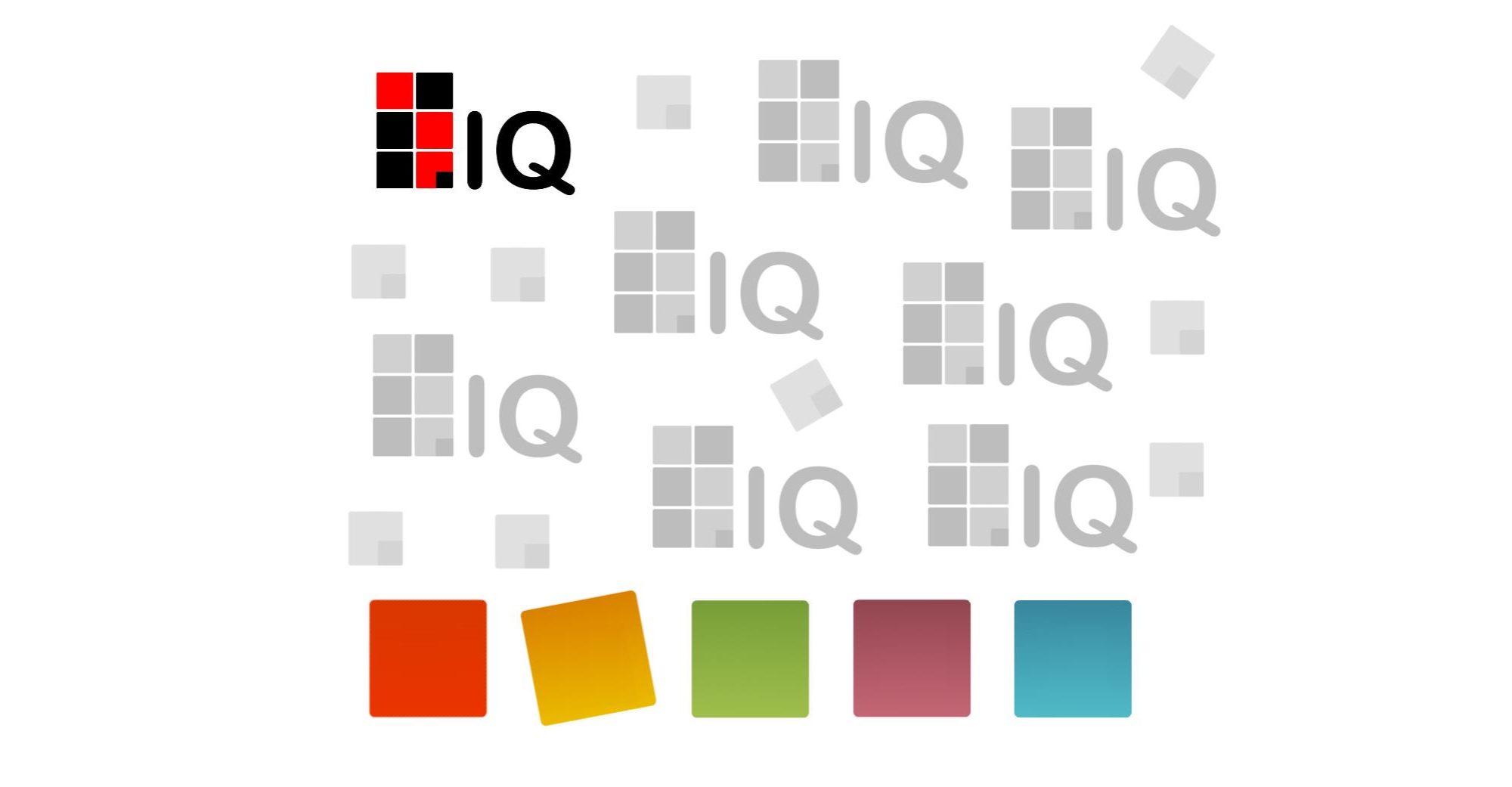Die meisten der im folgenden Abschnitt besprochenen Begriffe, werden in der Literatur nicht einheitlich gebraucht. Die Diskussion über die Bedeutung dieser Begriffe, also eine Diskussion auf rein metasprachlicher Ebene, soll hier nicht fortgeführt werden. In aller Kürze wird, wo dies aufgrund kontroverser Diskussionen angebracht erscheint, lediglich dargestellt, welche Definitionen weit verbreitet sind, um daraus abgeleitet den Sprachgebrauch und den Begriffsinhalt für diese Arbeit festzulegen.
Erregung, Aktivierung
Notwendige Voraussetzung für jedes menschliche Verhalten und Denken ist Erregung. Der Begriff Erregung soll im weiteren synonym mit dem Begriff der Aktivierung gebraucht werden. Durch die Aktivierung wird der Organismus in einen Zustand der Leistungsbereitschaft versetzt.
Im zentralen Nervensystem gibt es eine Funktionseinheit, die retikuläres Aktivierungssystem (RAS) genannt wird. Der wesentliche Teil dieses RAS ist die Formatio Retikularis. Diese wird durch Impulse in Erregung versetzt, die direkt auf Außenreize zurückgehen oder aus einer anderen Region des Gehirns stammen. Die Erregung der Formatio Retikularis ist die Ursache dafür, daß die anderen Teile des Zentralnervensystems in Funktionsbereitschaft versetzt werden. Dadurch kommt es zu einer Aktivierung des gesamten Informationsverarbeitungsvorgangs. Es muß unterschieden werden zwischen einem Aktivierungsniveau und Aktivierungsschwankungen. Ersteres wird tonische Aktivierung genannt, bestimmt die länger anhaltende Bewußtseinslage und die allgemeine Leistungsfähigkeit und verändert sich nur langsam. Die zweite nennt man phasische Aktivierung. Sie steuert die jeweilige Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit des Individuums in bestimmten Reizsituationen.[1] „Von den Erregungen und Spannungen, die mit Emotion, Motivation und Einstellungen einhergehen, hängt es ab, wieviel psychische Energie freigesetzt wird und als spezifische Antriebsspannung für das jeweilige Verhalten zur Verfügung steht. Mit erhöhter Antriebsstärke steigt die Wahrscheinlichkeit des Verhaltens… „[2]
Emotion, Antrieb, Trieb, Affekt
Einigkeit herrscht weitgehend darüber, daß Emotionen die grundlegenden menschlichen Antriebskräfte sind. Verschiedentlich werden von den Emotionen die Triebe oder Antriebe abgegrenzt. Emotionen werden nach dieser Sichtweise von äußeren Reizen bedingt, während Triebe von inneren Reizen ausgelöst werden. Nicht alle Autoren machen diese Unterscheidung. Teilweise werden auch Hunger und Durst als Emotionen bezeichnet.[3] Izard behauptet dagegen, daß Triebe teilweise Emotionen beeinflussen und daß Triebe Eigenschaften von Motivationen haben.[4] Es wird deutlich, daß die Definitionen weit auseinandergehen.
Nicht eindeutig unterschieden wird oft auch zwischen Emotionen, Affekten und Stimmungen. In diesem Zusammenhang werden drei verschiedene Ebenen häufig miteinander verwechselt: die subjektive Erlebnisebene, die neurophysiologischen Vorgänge und das beobachtbare Ausdrucksverhalten.[5]
Ein weit verbreiteter Ansatz, das Zustandekommen von Emotionen zu erklären, ist der von Schachter und Singer.[6] Schachter und Singer heben mit ihrem attributionstheoretischen Ansatz den kognitiven Bereich und die subjektive Erlebnisebene in den Vordergrund. Sie gehen davon aus, daß der Mensch seine Erregung bewußt wahrnimmt und sie im Rahmen eines Attributionsprozesses auf der Grundlage der wahrgenommenen Situation positiv oder negativ bewertet.[7] Buck wendet dagegen ein, daß durch diesen Ansatz die Bedeutung der kognitiven Vorgänge überbewertet würde.[8]
In den letzten Jahren setzt sich eine Sichtweise immer mehr durch, die davon ausgeht, daß eine Reihe von Emotionen genetisch vorgegeben sind.[9] Aus diesen grundlegenden Emotionen werden dann durch Kombination weitere Emotionen geformt, wobei die klassische Konditionierung eine wichtige Rolle spielt. „Welche Emotionen in Handlungssituationen empfunden oder wahrgenommen werden, und wie sie geäußert werden, wird wesentlich von den ‚Emotionsregeln‘ einer Kultur mitbestimmt.“[10]
Nach Darstellung einiger konträrer Standpunkte wird Emotion für diese Arbeit wie folgt definiert: (Dabei wird deutlich, daß sich die Definition in bezug auf die Verbindung zwischen Erregung und Emotion, an die Sichtweise von Schachter anlehnt.)
Emotion ist ein Bewußtseinszustand, der entweder positiv oder negativ erlebt wird. Die Emotion geht immer einher mit einer Aktivierung in entsprechender Höhe zur Stärke der Emotion (energetisierende Wirkung) und einer verhaltenssteuernden Wirkung (selektive Wirkung). Die Erregung wird als Bestandteil der Emotion erlebt. Emotionen werden von situationalen Gegebenheiten bedingt. Die Verhaltenssteuerung ist auf eine, entsprechend der Wahrnehmung der Situation subjektiv – affektive Bewertung der Erregung zurückzuführen. Diese Zuordnung der Emotion zur Erregung muß nicht unbedingt mit der Verursachung der Erregung übereinstimmen. Emotionen sind nicht starr, sondern verändern sich durch Lernerfahrungen, vor allem bezüglich ihrer Stärke.
Triebe sind entsprechend den Emotionen definiert, mit der Ausnahme, daß sie in erster Linie von inneren Reizen bedingt werden und die aktivierende Wirkung im Vordergrund steht, während die affektive Komponente zurücktritt. Der Begriff Antrieb wird dem des Triebes gleichgesetzt.
Affekt ist ebenfalls wie die Emotion definiert. Bei Affekt steht jedoch noch mehr als bei Emotion die Bewertung der Erregung im Vordergrund. Natürlich unterscheiden sich auch Affekte ganz klar in ihrer Stärke, die auf die Stärke der Aktivierung zurückzuführen ist. Affekte werden im weiteren im Mittelpunkt der Betrachtung stehen.
Motivation, Einstellung, Motiv, Bedürfnis, Präferenz
Eine Motivation entsteht nach verbreiteter Auffassung dann, wenn zu der aus der Emotion, dem Trieb oder dem Affekt resultierenden Aktivierung und der entsprechenden affektiven Färbung eine kognitive Zielorientierung hinzutritt. Oft wird auch der Emotion schon eine gewisse kognitive Komponente zugesprochen. „Die Motivation – verstanden als mehr oder weniger starke Tendenz, eine Handlung auszuführen – wird nach den meisten kognitiven Modellen von zwei Einflußgrößen bestimmt:
vom subjektiv gesehenen Ziel-Mittel-Zusammenhang,
vom subjektiv erwarteten Wert (Befriedigungswert) des Zieles.“[11]
Daraus abgeleitet, soll festgeschrieben werden:
Motivation ist ein hypothetisches Konstrukt. Dieses Konstrukt bezeichnet einen manifesten inneren Vorgang, der Antriebskomponenten und kognitive Komponenten enthält. Die Antriebskomponenten leiten sich aus Emotionen, Trieben und Affekten ab. Die kognitiven Komponenten aus dem subjektiv gesehenen Ziel-Mittel-Zusammenhang und dem subjektiv erwarteten Wert (Befriedigungswert) des Ziels. Diese Faktoren zusammen bedingen die Richtung und die Stärke der Motivation, die sich wiederum auf das daraus resultierende Verhalten auswirken.[12]
Auch der Begriff „Einstellung“ läßt sich auf die beiden oben genannten Determinanten Ziel-Mittel-Zusammenhang und Befriedigungswert zurückführen. Aus dieser Tatsache und der verbreiteten Verwendung in der Literatur leitet Kroeber-Riel die folgenden beiden Aussagen ab:
„Der Motivationsbegriff der kognitiven Theorie deckt sich weitgehend mit dem Einstellungsbegriff.“
und
„Die Untersuchung von Einstellung ersetzt meist die Untersuchung von Motivation.“[13]
Die Verwandtschaft der beiden Begriffe wird auch in der Definition von Allport deutlich, die als die umfassendste und gleichzeitig noch operationalisierbare Definition des Einstellungsbegriffes gilt. „An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual´s response to all objects and situations with which it is related.“[14]
Die so definierten Einstellungen setzen sich nach verbreiteter Meinung aus drei Komponenten zusammen.[15] Auch wenn manche Autoren teilweise weniger oder andere Faktoren als Bestandteile der Einstellung sehen [16], wollen wir uns doch an diese bewährte Dreiteilung halten.
Die kognitive Komponente, die vornehmlich dem Bereich des Denkens zuzuordnen ist und die subjektiv gefärbte Kenntnisse des Individuums über die Beschaffenheit des Objektes beinhaltet.
Die affektive Komponente, die vornehmlich dem Bereich der Emotion zuzuordnen ist und zu einer positiven oder negativen Bewertung eines Objektes führt.
Die konative Komponente, die die Bereitschaft des Individuums beinhaltet, in einer durch die beiden vorhergehenden Komponenten bestimmten Weise, bezogen auf ein Objekt zu handeln. Die konative Komponente stellt die Verbindung zwischen der Einstellung und dem Verhalten her.
Weitgehende Einigkeit herrscht darüber, daß die affektive Komponente eine begriffskonstitutive Dimension für Einstellungen darstellt.
Im weiteren soll der Begriff Motivation vor allem dann verwendet werden, wenn die Antriebskomponente im Vordergrund steht und der Begriff Einstellung, wenn die inhaltliche oder die affektive Komponente im Vordergrund steht.
Zu erwähnen bleibt noch der Begriff des Motivs, der gelegentlich in dieser Arbeit verwendet wird. Dieser Begriff wird in seiner weit verbreiteten Definition als individuelle, durch Sozialisierungsprozesse erworbene Konstante, die unser Verhalten in vielen Bereichen determiniert, von Herkner kritisiert.[17] Als Alternative führt Herkner eine, in neuer Zeit oft angewendete Konzeption des Begriffs Motiv als Regelkreis an.[18] Danach ist das Motiv durch das Streben charakterisiert, einen Ist-Wert in einen Soll-Wert zu überführen. Dieser Sichtweise soll im weiteren gefolgt werden, ohne daß darauf an dieser Stelle genauer eingegangen wird. Zu klären bleibt immer, ob der Soll-Wert genetisch vorgegeben oder im Rahmen eines Sozialisierungsprozesses erworben wurde. Weitgehend synonym wird in dieser Arbeit gelegentlich der Begriff Bedürfnis gebraucht. Dabei wird durch die Verwendung dieses Begriffs angedeutet, daß nicht ein einzelnes Motiv das Verhalten bedingt, sondern neben mehreren Motiven auch Persönlichkeitsmerkmale, sowie Merkmale der sozialen Umwelt das Verhalten beeinflussen.[19]
Der Unterschied zwischen Motivation und Motiv besteht vor allem darin, daß die Motivation meist auf einen kleinen Ausschnitt oder zeitlich begrenzten Bereich des Verhaltens Einfluß nimmt, während das Motiv meist auf einen größeren Teil des Verhaltens Einfluß nimmt und längere Zeit überdauert.
Ein letzter wichtiger Begriff verbleibt für diese Arbeit zu klären. Präferenzen sind wichtige Faktoren im Kaufentscheidungsprozeß. Wiswede sagt: „…, daß Aktivierungsprozesse sowie deren Emotionalisierung (in angenehm/unangenehm) die Grundlage der Präferenzbildung darstellt.“[20] Präferenzen sind Ergebnisse eines Vergleichsprozesses nach bestimmten Regeln. Diese Auswahlregeln fußen auf dem Prinzip der Nutzenmaximierung. Die Marke, die den größten Nutzen bringt, wird am meisten präferiert. Der Nutzen wird dadurch gemessen, inwieweit die Zielvorstellungen erfüllt werden. Wie wir später noch sehen werden, führt die Erfüllung von Zielvorstellungen zu einer affektiven Bewertung der Objekte. Die Auswahlregel kann dann nach dem hedonistischen Prinzip vorgehen, indem die angenehmste Alternative ausgewählt wird.
[1] vgl.: Hansen, F., (1972), S. 60 ff
[2] Kroeber-Riel, W., (1992), S. 52
[3] vgl.: Buck, R., (1988), S. 8ff
[4] vgl.: Izard, C. E., (1981), S. 64
[5] Auf den Begriff Stimmungen wird hier nicht näher eingegangen, da er für diese Arbeit nicht relevant ist.
[6] vgl.: Schachter S.; Singer, J. E., (1962)
[7] Auf diesen Ansatz wird nicht weiter eingegangen, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Der Leser sei auf die entsprechende Literatur verwiesen. z.B. Schachter, S.; Singer, J. E., (1962) oder Schachter, S., (1964)
[8] vgl.: Buck, R., (1988), S. 470
[9] vgl.: Plutchik, R., (1980); Izard, C. E., (1981) und Kemper, T.D., (1991)
[10] Kroeber-Riel, W., (1992), S. 102
[11] Kroeber-Riel, W., (1992), S. 139
[12] Eine ausgedehnte Diskussion des Begriffes Motivation und seines Wandels im Zeitablauf, vor dem Hintergrund der sich wandelnden psychologischen Theorien, findet man bei Atkinson. (vgl.: Atkinson, J. W., (1975), S. 434ff)
[13] Kroeber-Riel, W., (1992), S. 139
[14] Allport, G. W., (1967), S. 3
[15] vgl.: Irle, M., (1967), S. 196-197 und Howard, J. A.; Sheth, J. N., (1969), S. 128-131 und S. 192-195
[16] vgl.: Nolte, H., (1976), S. 12
[17] vgl.: Herkner, W., (1993), S. 53
[18] vgl.: Herkner, W., (1993), S. 63
[19] vgl.: Wiswede, G., (1973), S. 96
[20] Wiswede, G., (1991), S. 314