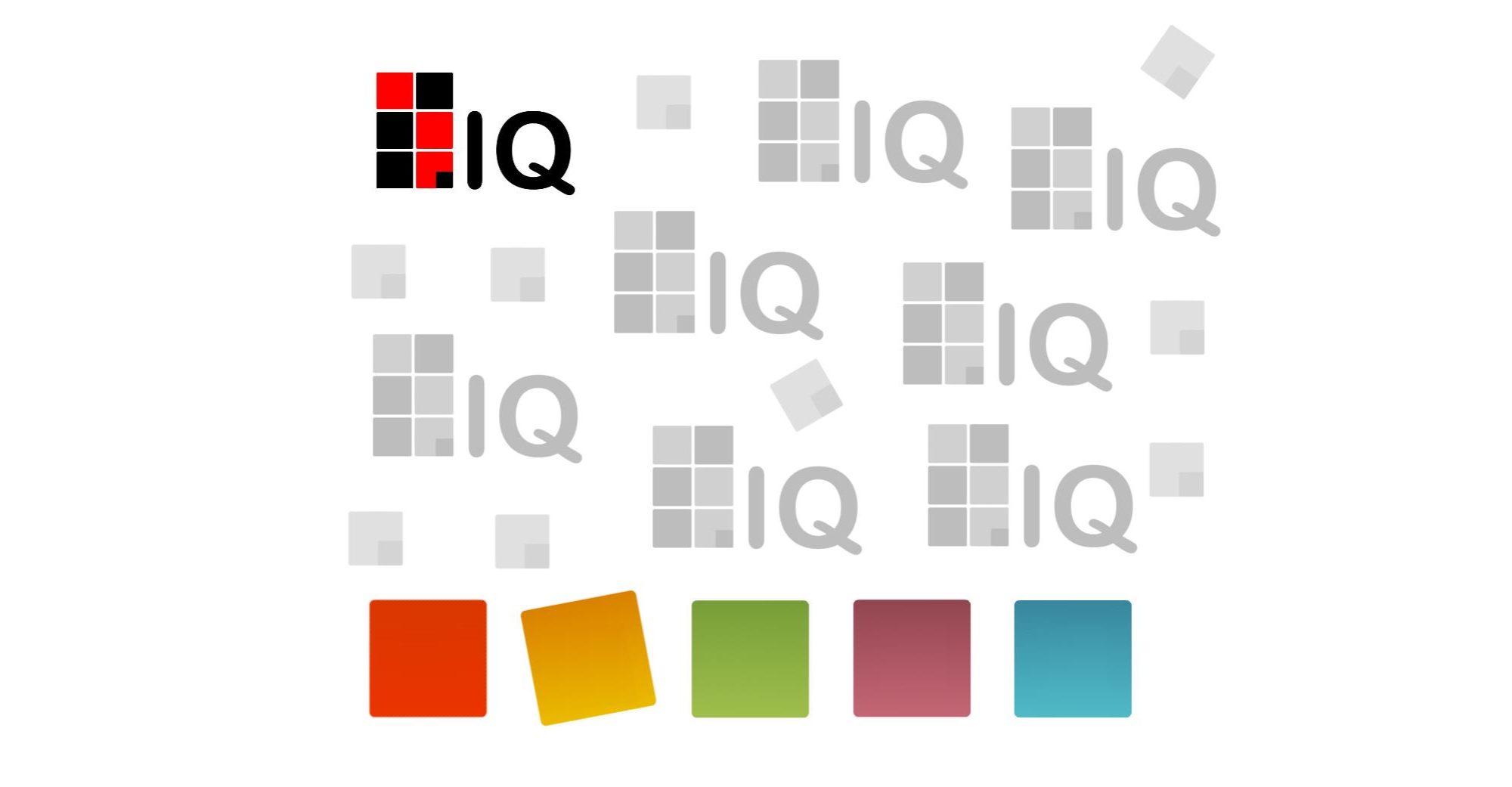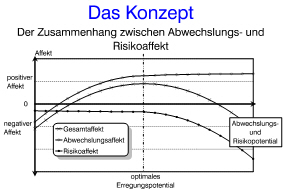Allgemeine Grundlagen
Es gibt in der Literatur eine ganze Reihe verschiedener Definitionen des Begriffs Markentreue.[1] Allen gemeinsam sind zwei Aussagen. Die erste notwendige Eigenschaft dafür, daß man von Markentreue sprechen kann, ist die, daß die Käufe nicht zufällig erfolgen, sondern bestimmte Marken signifikant mehr gekauft werden, als dies durch Zufall zu erklären wäre. Als zweite notwendige Eigenschaft wird gefordert, daß markentreue Konsumenten eine positive Einstellung zu ihrer Marke haben.[2]
Darüber hinaus kann man die verschiedenen Konzepte der Markentreue in drei Kategorien einordnen[3]: behavioristische Markentreue-Konzepte, einstellungsorientierte Markentreue-Konzepte und einstellungsgeprägte Verhaltenskonzepte der Markentreue.
Behavioristische Markentreue-Konzepte sind solche, die sich in erster Linie mit dem gezeigten Verhalten beschäftigen und die zugrundeliegenden Einstellungen gar nicht oder nur am Rande behandeln. Zu diesen Konzepten zählen das Kaufreihenfolge-Konzept, das Marktanteils-Konzept, das Markenanzahl-Konzept, das Kaufzeitpunkt-Konzept und das Wiederkaufwahrscheinlichkeits-Konzept. Insbesondere die stochastischen Markenauswahl-Modelle, die auf dem Konzept der Wiederkaufwahrscheinlichkeit beruhen, haben in der angelsächsischen Literatur große Beachtung und Verbreitung gefunden und werden dort oft als operationale Definitionen gebraucht. Aus diesem Grunde und weil einige der im folgenden gemachten Aussagen auf Untersuchungen beruhen, die sich auf solche Modelle beziehen, sollen die wichtigsten hier kurz dargestellt werden. Es gibt noch eine große Anzahl weiterer Modelle, die aber meist nur Kombinationen der hier aufgeführten sind. Implizit schließt sich das später erarbeitete Modell an die Betrachtungsweise des Linearen Lernmodells und des „new trier“- Modells an. Eine Kritik der verschiedenen Modelle würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Für eine Kritik der Modelle und Anwendungsbeispiele siehe Massy[4] oder zusammenfassend Wierenga[5] oder Nolte[6].
Das Bernoulli-Modell
Modelle dieser Gruppe haben gemeinsam, daß das mögliche Verhalten dichotomisiert wird. Es gibt nur zwei Verhaltensweisen, entweder „1“ = die interessierende Marke wird gekauft oder „0“ = eine andere Marke wird gekauft. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Verhaltensweisen wird als Zufallsvariable betrachtet. Von einer Zufallsvariablen wird gesagt, daß sie eine Bernoulli-Verteilung hat, wenn sie nur zwei Werte annehmen kann, nämlich 1 und 0. Der Auswahlprozeß wird Bernoulli-Prozeß genannt, wenn die Marke 1 mit der Wahrscheinlichkeit p und die Marke 0 mit der Wahrscheinlichkeit (1-p) ausgewählt wird. Die Kaufhistorie hat bei dieser Betrachtung keine Auswirkung auf die anstehende Kaufentscheidung, da die Wiederkaufwahrscheinlichkeit durch p vorgegeben ist. Es existieren homogene und heterogene Bernoullimodelle. Der Unterschied zwischen diesen besteht in der Verteilung der Wiederkaufwahrscheinlichkeit. Während beim homogenen Modell die Wahrscheinlichkeit p für alle Individuen gleich ist, ist beim heterogenen Modell diese Wahrscheinlichkeit p über die Gesamtheit verteilt. Das bedeutet, es gibt Konsumenten mit einer höheren und solche mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit, der Mittelwert ist jedoch immer p.
Das Markov-Modell
Dieses Modell geht auf den russischen Mathematiker Markov zurück.[7] Charakteristikum dieses Modells ist, daß die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die alternativen Marken in zurückliegenden Perioden ermittelt und aus dieser Verteilung die Wahrscheinlichkeit für markentreues Verhalten in der kommenden Periode berechnet wird. Das Modell geht davon aus, daß nur einige wenige zurückliegende Käufe einen Einfluß auf das Kaufverhalten haben. Das meistbenutzte Modell ist das „first order Markov Model“. Für dieses spezielle Markov-Modell ist nur die letzte Kaufhandlung für die aktuelle Kaufentscheidung relevant. Alle vor der letzten Kaufhandlung liegenden Käufe haben demnach keinen Einfluß mehr auf die aktuelle Entscheidungssituation. Es wird wieder unterschieden zwischen einer homogenen und einer heterogenen Variante. Während bei der homogenen Variante jeweils einheitliche Übergangswahrscheinlichkeiten für die gesamte Population ermittelt werden, wird bei der heterogenen Variante von einer Streuung ausgegangen. Das heterogene Modell vereint damit zwei positive Eigenschaften: Erstens wird die Kaufhistorie in Betracht gezogen und zweitens werden nicht alle Individuen gleich behandelt. Da bei diesem Modell, im Gegensatz zum Bernoulli-Modell, nicht nur zwei Zustände relevant sind, sondern schon beim Zwei-Produkt-Markt vier Übergangswahrscheinlichkeiten existieren, sind mindestens zwei Wahrscheinlichkeiten zu dessen Beschreibung notwendig. Bei dem n-Produkt-Markt steigen die notwendigen Wahrscheinlichkeiten entsprechend. Für jede dieser Wahrscheinlichkeiten müßte eigentlich eine eigene Verteilung ermittelt werden. Um die Komplexität zu reduzieren, werden in der Praxis meist Relationen zwischen den verschiedenen Wahrscheinlichkeiten festgesetzt, so daß letztendlich nur noch eine Wahrscheinlichkeit p untersucht werden muß.
Das lineare Lern-Modell
In einem „first-order Markov model“ kann die Wiederkaufwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von dem in der Vorperiode erworbenen Produkt nur zwei Werte annehmen. Beim linearen Lernmodell ist die Situation komplizierter: Die Wahrscheinlichkeit eines Wiederkaufes im Zeitpunkt (t+1) also p(t+1) ergibt sich aus der Formel: pt+1 = e+gpt.
Im Zwei-Produkt-Fall, den wir hier betrachten wollen, weil er der in der Literatur meistbehandelte ist, existieren zwei Formeln, die den Einfluß einer bestimmten Kaufhandlung im Zeitpunkt t auf die Kaufwahrscheinlichkeit im Zeitpunkt t+1 determinieren. Es gibt eine Formel, die die Wahrscheinlichkeit für Produkt 1 in t+1 bestimmt, wenn Produkt 1 in t gewählt wurde, und es gibt eine Formel, die die Wahrscheinlichkeit für Produkt 1 in t+1 bestimmt, wenn Produkt 1 in t nicht gewählt wurde. Die Formeln sind simple Geradengleichungen. Aus diesem Grunde läßt sich das Modell sehr einfach graphisch darstellen. Die Parameter in den Geradengleichungen werden durch Schätzverfahren aus der Kaufhistorie ermittelt.
Das probabilistische Diffusionsmodell
Bei diesem erst in neuerer Zeit entwickelten Modell ist die Wiederkaufwahrscheinlichkeit unabhängig von der Kaufhistorie. Insoweit handelt es sich eigentlich um ein Bernoulli-Modell. Bei dem probabilistischen Diffusionsmodell wird jedoch nicht angenommen, daß die Wiederkaufwahrscheinlichkeit vom Zufall abhängig ist. Stattdessen wird die Wiederkaufwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von externen Effekten gesehen.[8]
Das „new trier“-Modell
Dieses Modell gliedert die Entwicklung der Wiederkaufwahrscheinlichkeit in zwei Phasen. In der ersten Phase wird davon ausgegangen, daß der Konsument wahllos verschiedene Marken ausprobiert. Der Auswahlprozeß gleicht also einem Bernoulliprozeß. Im Anschluß an diese Phase findet eine Bewertung aller Marken statt. Dadurch ändern sich die Wiederkaufwahrscheinlichkeiten abrupt, bleiben dann jedoch für die folgenden Kaufentscheidungen gleich. Es liegt also erneut ein Bernoulliprozeß vor. Darüber hinaus wird jeder Marke nicht nur eine Wiederkaufwahrscheinlichkeit, sondern auch eine Ablehnungswahrscheinlichkeit zugeordnet. Diese Ablehnungswahrscheinlichkeit nimmt mit abnehmender Rate von Kauf zu Kauf zu und nähert sich einem Grenzwert. Dies führt jedoch nicht dazu, daß die Wiederkaufwahrscheinlichkeit abnimmt. Diese bleibt vielmehr während des gesamten Prozesses gleich oder wird im Falle des Eintretens der Ablehnung gleich Null.[9]
„Zusammenfassend kann man sagen, daß sich die skizzierten modell-theoretischen Forschungsstrategien kaum zur Erklärung des Treueverhaltens eignen. Sie zeichnen sich jedoch durch wenige und einfach zu beschaffende Variablen aus, um unter Berücksichtigung absatzpolitischer Aktivitäten die Markentreue bzw. den Markenwechsel in der Zukunft zu prognostizieren.“[10]
„The degree to which loyalty to brand names may be said to exist is partially a function of the method of measurement and individual interpretation.“[11]
Wie die beiden Zitate andeuten, ist Markentreue ein hypothetisches Konstrukt, dessen Definition dem Belieben des Forschers unterliegt. Zwar kann man mit Hilfe dieses Konstruktes ermitteln, ob Markentreue nach der selbstkonstruierten Definition vorliegt und prognostizieren, ob die Indikatoren dieses Konstruktes auch in Zukunft zu beobachten sein werden, die beschriebenen Modelle helfen jedoch nicht bei der Frage, wieso die Indikatoren auftreten. Aus diesem Grunde werden die oben beschriebenen Modelle im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande behandelt.
Besser geeignet sind die einstellungsorientierten Modelle.
Einstellungsorientierte Markentreue-Konzepte sind solche, die die Markentreue in Einstellungskategorien definieren und die Verhaltenskomponente nur insoweit beachten, als davon ausgegangen wird, daß Einstellungen zu einer entsprechenden Markenauswahl führen. Zu diesen Konzepten gehören das Markenpräferenz-Konzept, das Wiederkaufabsichts-Konzept und das Substitutionsbereitschafts-Konzept. Bisher existieren relativ wenige ausformulierte einstellungsorientierte Modelle. Der größte Mangel der existierenden Modelle besteht darin, daß keine Aussage über den Zusammenhang zwischen der Einstellung als Indikator und der tatsächlich ausgeführten Kaufhandlung gemacht wird. Fazio trifft im Rahmen seiner Untersuchung eine Aussage, die darauf schließen läßt, daß der Zusammenhang bei markentreuen Einstellungen relativ hoch ist. „Previous research has demonstrated that behaviour is more accurately predicted from attitudes formed via direct, behavioral interaction with the attitude object than from attitudes developed via indirect, nonbehavioral experience.“[12] Da Markentreue immer mit einer Erfahrung mit dem Produkt verbunden ist, trifft diese Aussage auf Markentreue-Einstellung zu.
Einstellungsgeprägte Verhaltenskonzepte der Markentreue sind solche, die beide Komponenten ausführlich behandeln und die funktionale Abhängigkeit zwischen beiden als konstitutiv betrachten. Sie sind dadurch näher an der Realität, haben aber oft den Nachteil, wesentlich komplexer zu sein. Trotzdem gelingt es auch diesen Modellen nicht, den Zusammenhang zwischen Einstellungen und Kaufhandlungen eindeutig zu klären.[13]
In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf den Einstellungen. Es werden keine Kaufhandlungen beobachtet, sondern nur Einstellungen, Emotionen und Erregungspotentiale durch Befragung ermittelt. Zwar wird eine Wahrscheinlichkeit für einen Wiederkauf erfragt werden, diese ist jedoch eher im Sinne der konotativen Komponente der Einstellung als im Sinne eines Verhaltens zu interpretieren.
Explikation und Diskussion einer Begriffsabgrenzung
Die wichtigsten Gesichtspunkte des Phänomens Markentreue faßt Jacoby in der folgenden Definition zusammen. Es muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß auch diese Definition keine Aussage darüber macht, warum es zu Markentreue kommt, obwohl Jacoby[14] dies behauptet. Vielmehr liefert diese Definition nur ein Set von sechs notwendigen und zusammen hinreichenden Bedingungen, um zu entscheiden, ob es sich um Markentreue handelt oder nicht. Für den entscheidenden Faktor seiner Definition (bias), führt Jacoby darüber hinaus eine behavioristische Operationalisierung an, die nichts mit dem durch Einstellungen geprägten „bias“ zu tun hat. Damit erfüllt Jacoby zwar nicht die Ansprüche, die er an seine Definition stellt[15], für die Zwecke der vorliegenden Arbeit ist die Definition jedoch ausreichend, (BL=brand-loyalty):
„…BL is (1) the biased (i.e., nonrandom), (2) behavioral response (i.e., purchase), (3) expressed over time, (4) by some decision-making unit, (5) with respect to one or more alternative brands out of a set of such brands, and (6) is a function of psychological (decision-making, evaluative) processes.“[16] [17]
Die Punkte (1) und (6) können zusammenfassend interpretiert werden. Sie drücken aus, daß die Kaufentscheidung keine Zufallsentscheidung ist, sondern aufgrund von Bewertungen zustande kommt. In diese Bewertungen gehen dabei nicht nur die aktuell wahrgenommenen Eigenschaften der Marke ein, sondern zusätzlich auch Einstellungen, die aufgrund vorhergehender Erfahrungen oder früherer Informationsaufnahme gebildet wurden. Dabei setzt diese Definition nicht voraus, daß bei jeder Entscheidung eine umfangreiche Bewertung stattfinden muß. Am Ende dieses Informationsverarbeitungsprozesses steht auf jeden Fall eine Einstellung dem Produkt gegenüber. Der Punkt (1), also die Voreingenommenheit, ist der zentrale Punkt in der Definition von Jacoby, da alle anderen Bedingungen entweder sehr nahe an anderen in der Literatur vertretenen Definitionen bleiben oder sich aus dem Zusammenhang von selbst ergeben.[18]
Aufgrund der semantischen Bedeutung des Wortes „Treue“ (oder auch „loyalty“), wird eine Dauerhaftigkeit und eine Bindung an die Marke gefordert. In diesem Sinne wird der Teil (3) zu interpretieren sein. Schon ein zweiter Kauf einer Marke kann als Markentreue bezeichnet werden, wenn die übrigen Bedingungen erfüllt sind.
Aus (5) geht hervor, daß sich Markentreue nicht auf eine einzige Marke beschränken muß. Es werden grundsätzlich zwei Arten von Markentreue unterschieden: Mono-Loyalität und Dual- oder Multi-Loyalität[19]. Unter Mono-Loyalität wird die Neigung zu regelmäßigem Kauf ein- und derselben Marke verstanden. Unter Dual- oder Multi-Loyalität verstehen wir die Neigung zum regelmäßigen Kauf zweier oder einiger weniger Marken. Für diese Untersuchung wollen wir nur im Falle der Mono-Loyalität von Markentreue sprechen. Abwechslungsappetenz als einer der wichtigen Faktoren des Markenwechsels kann nämlich durchaus auch durch den Wechsel zwischen einzelnen Marken innerhalb eines Multi-Loyalitäts-Sets befriedigt werden. Wenn die Multi-Loyalität zugelassen würde, gingen Markentreue und Abwechslungsverhalten ineinander über. Dies mag in manchen Produktkategorien der Fall sein und widerspricht nicht dem später vorgeschlagenen Konzept. Die empirische Überprüfung des Konzeptes bei Berücksichtigung dieses Falles würde dadurch jedoch erheblich erschwert.
Trotzdem verlangt Bedingung (5), daß in der Kaufentscheidungssituation Alternativen vorliegen müssen. Das „evoked set“ muß mehr als eine Marke enthalten. „The brands that become alternatives to the buyer´s choice decision are generally a small number, collectively called his ‚evoked set‘. The size of the evoked set is at best a fraction of the brands that he is aware of and a still smaller fraction of the total number of brands that are actually available in the market.“[20] „Only evoked brands have a highly positive intention.“[21] (to be bought)[22].
Wenn in der Entscheidungssituation keine akzeptablen Alternativen vorliegen, sprechen wir nicht von Markentreue, da die Entscheidung dann nur eine Entscheidung zwischen Kauf oder Nicht-Kauf ist.
Durch (4) wird eindeutig darauf hingewiesen, daß weder der Person, die die Marke kauft, noch der Person, die die Marke verwendet, die Markentreue zuzurechnen ist, sondern nur der Person, die die Markenentscheidung trifft. Dabei wird in der Definition bewußt nicht von Person, sondern von Entscheidungseinheit gesprochen, da die Entscheidung auch von der gesamten Haushaltsgemeinschaft oder von einer Teilgruppe des Haushalts gemeinsam getroffen werden kann.
Erkennbar wird die Markentreue erst durch die Kaufhandlung an sich. Dies ist mit Punkt (2) gemeint. Im Rahmen dieser Untersuchung beschränken wir uns, wie schon oben angedeutet, auf die Aufstellung eines einstellungsorientierten Markentreue-Konzeptes. Deshalb lassen wir diesen Punkt außen vor und sprechen auch ohne die effektiv beobachtete Kaufhandlung von Markentreue, wenn die übrigen Bedingungen erfüllt sind. Die Begriffe Markentreue und markentreue Einstellung werden in dieser Arbeit weitgehend synonym gebraucht, da hier Einstellungen untersucht werden.
Abschließend sei angemerkt, daß es noch eine große Anzahl von ähnlich oder synonym gebrauchten Begriffen gibt, wie Kundentreue, Produktreue, Modelltreue, Firmentreue, Betriebstreue, Qualitätstreue oder verschiedene Differenzierungen von Markentreue. Da eine negative Abgrenzung all dieser Begriffe an dieser Stelle zu umfangreich würde, beschränken wir uns darauf, den Begriff hier in positiver Richtung zu definieren, wie dies oben geschehen ist. Für die negative Abgrenzung wird auf Nolte verwiesen, dessen gesamte Untersuchung ebenfalls auf der Markentreue-Definition von Jacoby beruht.[23]
[1] Jacoby stellt insgesamt 53 Definitionen von Markentreue, die bis 1976 in der Literatur aufgetaucht sind zusammen und diskutiert diese. (vgl.: Jacoby, J.; Chestnut, R. W., (1978), S. 35-41).
[2] vgl.: Nolte, H., (1976), S. 10-11
[3] vgl.: Nolte, H., (1976), S. 15ff und Bass, F. M.; Givon, M. M.; Kalwani, M. U.; Reibstein, D.; Wright, G. P., (1984)
[4] vgl.: Massy, W. F.; Montgomery, D. B.; Morrison, D. G., (1970)
[5] vgl.: Wierenga, B., (1974)
[6] vgl.: Nolte, H., (1976)
[7] vgl.: Fisz, M., (1965)
[8] vgl.: Montgomery, D.B.; Morrison, D.G., (1969)
[9] vgl.: Aaker, D. A., (1970), (1971), (1972)
[10] Weinberg, P., (1990), S. 164
[11] Guest, L. P., (1944), S. 27
[12] Fazio, R.H.; Zanna, M. P., (1978), S. 228
[13] vgl.: Nolte, H., (1976), S. 82 ff
[14] vgl.: Jacoby, J.; Kyner, D.B., (1973), S. 2
[15] vgl.: Tarpey, L.X., (1974)
[16] Jacoby, J.; Kyner, D.B., (1973), S. 2
[17] Eine ähnliche Definition benutzen auch Brown (Brown, G. H., (1952/1953)), Nolte (Nolte, H., (1976)) und Day (Day, G. S., (1969)) in ihren Untersuchungen.
[18] vgl.: Tarpey, L.X., (1974), S. 215
[19] vgl.: Gierl, H. et al., (1993), S. 104
[20] Howard, J.A.; Sheth, J. N., (1969), S. 26
[21] Laroche, M.; Sadokierski, R., (1994), S. 3
[22] Anmerkung des Autors
[23] vgl.: Nolte, H., (1976), S. 104-183