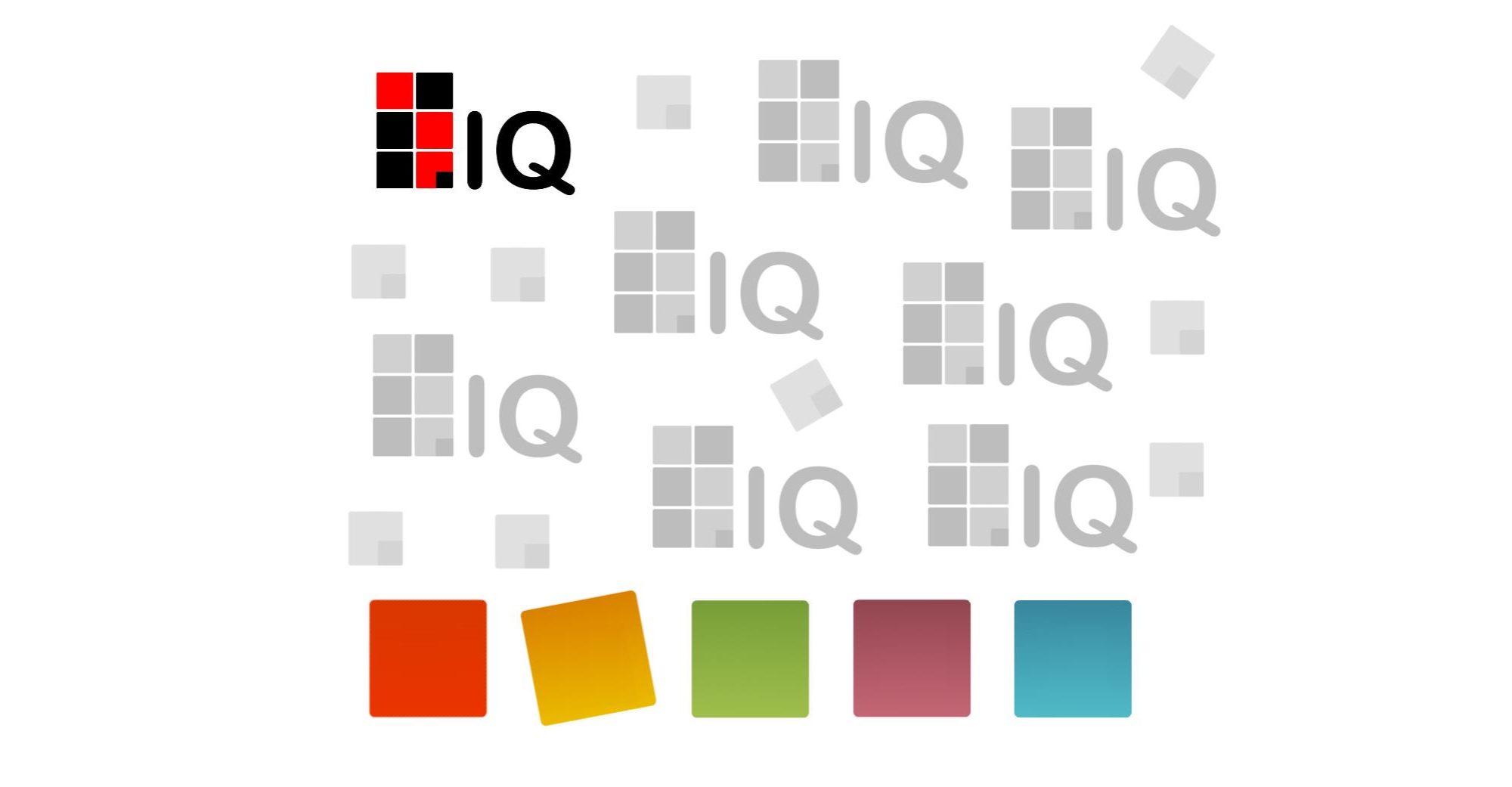Strategien allgemein
Aus den beiden Komponenten des Risikos lassen sich logisch drei Problemlösungsstrategien ableiten:
Reduzierung der negativen Konsequenzen unter Konstanthaltung der aktuellen Unsicherheit
Reduzierung der Unsicherheit unter Konstanthaltung der negativen Konsequenzen
Reduzierung sowohl der Unsicherheit, als auch der negativen Konsequenzen.
Bei der Diskussion um Risikoreduktionsmethoden wie auch bei der Markentreue, steht immer die Unsicherheitsreduktion im Vordergrund. Wenig Interesse hat bisher – im Zusammenhang mit der Risikoreduktion – die Komponente Wichtigkeit oder Konsequenzen gefunden. Dies ist verwunderlich, da es sich erstens um ein Zwei-Komponentenmodell handelt und zweitens die Wichtigkeit eine bedeutende Rolle im Rahmen der dissonanztheoretischen Modelle spielt.
Mögliche Maßnahmen im Rahmen der ersten Strategie sind zum Beispiel: Reduktion des Anspruchsniveaus, Ausschaltung möglicher negativer Folgen und Reduzierung der zum Erwerb der Marke einzusetzenden Mittel. Wenn es um den Erwerb von kurzlebigen Konsumgütern des täglichen Bedarfs geht, die im Mittelpunkt der empirischen Untersuchung stehen sollen, sind diese Maßnahmen jedoch meist nicht realisierbar oder nicht sinnvoll.
Aus diesem Grund sind in der Realität wesentlich öfters Strategien zu beobachten, die darauf abzielen, die Unsicherheit zu reduzieren. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß zur Unsicherheitsreduktion immer die Mittel eingesetzt werden, die mit dem geringsten Aufwand verbunden sind (siehe Kapitel 2.6.2.). Den geringsten Aufwand verursacht im Regelfall die Aktivierung von Gedächtnisinhalten, das heißt in diesem Fall Lernerfahrungen. Für diese Aussage sprechen auch die Ergebnisse von Roselius.[1] Er nennt 11 verschiedene Möglichkeiten der Risikoreduktion und stellt eine Reihenfolge auf. Er stellt fest, daß die Markentreue – unabhängig von der Art des Risikos – bei weitem am häufigsten genannt wurde. Kritisiert wird seine Studie von Derbaix[2], weil Roselius den Befragten in den Fragebögen zwar die spezifische Situation schilderte, sich aber nicht auf einzelne Produkte bezog. Damit hatten die Befragten nur zu entscheiden, welche Risikoreduktionsmethoden sie im allgemeinen als sinnvoll ansahen. Es ist damit zu rechnen, daß es erhebliche Verhaltensunterschiede zwischen verschiedenen Produktkategorien gibt. Allerdings konnte Roselius in seiner Studie feststellen, daß die Art der gewählten Risikoreduktionsstrategie von der Art der zu erwartenden Konsequenzen abhängt. „…buyers prefer some relievers to others depending upon the kind of loss involved,…“[3]. Markentreue steht grundsätzlich an erster Stelle. Derbaix machte bei seiner Studie diesen Fehler nicht und kam trotzdem zu dem Ergebnis, daß Markentreue die wichtigste Risikoreduktionsmethode ist. Schon Bauer[4] nannte Markentreue als wichtige Risikoreduktionsmethode und auch Cunningham[5] beobachtete die Bedeutung der Markentreue in diesem Zusammenhang. Es ist allerdings zu beachten, daß es sich sowohl bei Cunningham, als auch bei Roselius lediglich um Befragungen handelt. Es wurde kein Verhalten beobachtet, sondern lediglich Einstellungen erfragt. Die Validität dieser Untersuchung läßt sich zum Beispiel an folgender Tatsache festmachen. So lag die Strategie, hohe Preise mit hoher Qualität gleichzusetzen bei Roselius durchgängig auf dem letzten oder vorletzten Platz.[6] Zwar gilt diese Einstellung in der Bevölkerung als verpönt, trotzdem ist sie bei vielen Produktkategorien häufig zu beobachten. Trotz dieser Widersprüche kann nicht geleugnet werden, daß Markentreue eine wichtige Bedeutung bei der Reduktion des Risikos hat. Um die Bedeutung der Marke im Rahmen der Informationsverarbeitung nachzuweisen, untersuchte Jacoby[7] die Verwendung von Produktattributen im Rahmen der Entscheidungsfindung. Er wies nach, daß Markennamen als „information chunks“ dienen, und als solche bei weitem am häufigsten von allen Attributen der Marke als Grundlage der Auswahlentscheidung in Anspruch genommen werden. Wenn der Markenname Grundlage der Entscheidung ist, entspricht dies markentreuem Verhalten.
Wenn im Gedächtnis keine Informationen über bekannte Alternativen zur Verfügung stehen, müssen diese durch zusätzliche kognitive Anstrengungen beschafft werden. Das bedeutet, daß Informationen über die zur Auswahl stehenden Alternativen beschafft und verarbeitet werden müssen. Wenn auch auf diesem Wege keine befriedigende Reduktion der Unsicherheit zu erreichen ist, müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um den Bereich der Untersuchung weiter auszudehnen und Informationen aus dem Umfeld mit in die Überlegungen einzubeziehen. Dadurch entsteht ein noch höherer Aufwand. Durch diese Darstellung wird deutlich, daß das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis der Risikoreduktion immer schlechter wird. Dieses Mißverhältnis wird dadurch abgeschwächt, daß die Ziele der Informationsverarbeitung erweitert werden. Wenn dem Ziel der Risikoreduktion das Ziel nach zusätzlicher Erregung durch neue und ungewöhnliche Informationen hinzugefügt wird, kann sich das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis wieder verbessern. Trotzdem wird es auch dann im Laufe der Informationsverarbeitung wieder schlechter. Das immer schlechter erscheinende Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis wird durch drei Variablen determiniert:
durch zunehmenden Zeitaufwand
durch zunehmenden Energieaufwand und
durch abnehmende Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Informationsverarbeitung
…die mit jeder zusätzlich zu verarbeitenden „Einheit“ an Information verbunden sind.[8]
Erst wenn die eben dargestellten Strategien nicht zum Erfolg führen, wird die Strategie der Reduktion der Konsequenzen eingesetzt.
Wenn weder der eine noch der andere Weg noch eine Kombination beider zu einem befriedigenden Ergebnis führen, kann dies zu ernsthaften mentalen Problemen führen. Reaktionen auf solche Situationen sind zum Beispiel: Verweigerung, Unterdrückung, Isolation, Sublimation etc.[9] Bauer berichtet, daß Autokäufer am Ende ihrer Entscheidungsphase in einen Panikzustand verfallen, aus dem sie dann durch den Kauf möglichst kurzfristig entfliehen wollen.[10] Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß der Käufer aufgrund der Komplexität des Produktes nur unzureichend in der Lage ist, die Unsicherheit zu reduzieren. Gleichzeitig kommt dieser Entscheidung wegen der finanziellen Belastung durch den Kauf ein besonderes Gewicht zu, das kaum zu reduzieren ist. Solche Verhaltensweisen werden uns im weiteren nicht interessieren. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Situation, in der Markenerfahrung zur Verfügung steht und auch benutzt wird. Außerdem stehen im Mittelpunkt der Betrachtung Verbrauchs- und nicht Gebrauchsgüter. Es bleibt weiteren Forschungsvorhaben vorbehalten, zu prüfen, ob die gefundenen Ergebnisse auch auf Gebrauchsgüter übertragen werden können. Sheth und Venkatesan[11] stellten dazu fest, daß mit zunehmender Wiederkaufsrate die Neigung zur Informationssuche abnimmt, während gleichzeitig die Tendenz zur Markentreue zunimmt.
Strategien im Zeitablauf
Die einzelnen Strategien können prinzipiell immer wieder angewandt werden. Im Speziellen bei der Markentreue kann die wiederholte Anwendung dieser Strategie zu einer Veränderung der Entscheidungsgrundlage, also der gespeicherten Informationen, führen. Eine Veränderung der Entscheidungsgrundlage führt wiederum dazu, daß sich die Wahrscheinlichkeit der Anwendung der Strategie verändert.
Wenn einmal bestimmte Gedächtnisinhalte über eine Marke vorliegen, die dann immer wieder zu markentreuem Verhalten führen, hat dies Auswirkungen auf das mit dieser Marke verbundene Risiko. Wenn eine Marke über einen längeren Zeitraum verwendet wird, sind sowohl die mit ihr verbundene Unsicherheit, als auch die Konsequenzen einem bestimmten Wandel unterworfen. Dieser Wandel ist auf die mit der Marke gemachten Erfahrungen und die daraus resultierende Gewöhnung zurückzuführen. Erfahrungen bedeuten nichts anderes als die Veränderung von Gedächtnisinhalten in bezug auf die Qualitätsverteilung.
Wenn der Konsument zum ersten Mal eine Marke kauft, steht er der gesamten Qualitätsverteilung der spezifischen Produktkategorie gegenüber. Selbstverständlich ist diese Verteilung abhängig von der subjektiven Wahrnehmung. Die erste Entscheidung wird aufgrund von naiven Regeln oder Heuristiken geschehen, sofern nicht in anderen Produktkategorien gelernte Zusammenhänge im Zuge einer Generalisierung auf diese Produktkategorie übertragen werden können. Das ist der Zustand, den Bettman[12] „inherent risk“, also das der Produktkategorie innewohnende Risiko nennt. Diesem ist der Konsument ausgesetzt, bevor er sich mit der Produktkategorie auseinandergesetzt hat. Die Höhe dieses Risikos ergibt sich nach Bettman daraus, inwieweit der Konsument davon ausgeht, daß er eine angemessene Auswahlregel findet, um das beste Produkt zu ermitteln. Das beste Produkt ist dasjenige, das die Zielvorstellungen am besten erfüllt. Darüber hinaus ist die Größe des „inherent risk“ davon abhängig, wie wichtig es für den Konsumenten ist, eine zufriedenstellende Auswahl zu treffen, also davon, wo seine Risikotoleranzschwelle liegt.
Wenn die gekaufte Marke konsumiert wurde, kann der Konsument damit beginnen, diese innerhalb der Qualitätsverteilung einzuordnen. Damit wird die Unsicherheit bezüglich dieser Marke reduziert. Parallel zu dieser Einstufung in bezug auf die Qualitätsverteilung kann er das Maß der drohenden Konsequenzen abschätzen. Diese Einordnung kann sich bei komplexen Produkten unter Umständen über mehrere Verwendungen erstrecken. Wenn er sich ein Bild über die Qualität der Marke gemacht hat, bedeutet dies, daß er die funktionelle Leistungsfähigkeit und damit die Wahrscheinlichkeit, daß Zielvorstellungen nicht erfüllt werden, einschätzen kann. Damit hat er dann aber auch eine klare Vorstellung über die Konsequenzen, die durch die Verwendung der Marke drohen. Dieser Zustand ist sicher der Idealzustand und wird selten erreicht werden.
Ein Restrisiko bleibt auf jeden Fall weiterhin bestehen. Der Konsument weiß nicht, inwieweit die Marke Qualitätsschwankungen unterliegt. Dieser Unsicherheitsfaktor kann durch Informationsverarbeitung kaum ausgeschaltet werden, sondern nur durch langzeitige Lernerfahrungen.
Den Zustand, nachdem sich der Konsument angemessen über die Produktkategorie und die spezielle Marke informiert hat, nennt Bettman[13] „handled risk“. Das „handled risk“ ist tendenziell umso größer, je größer das „inherent risk“ war und umso kleiner, je mehr Information aufgenommen wurde, je nützlicher diese Information empfunden wurde und je mehr man diesen Informationen vertraut. Das „handled risk“ sinkt also mit der durchschnittlichen Vertrautheit mit den Marken und der Produktkategorie.
Wie lange es dauert, bis die Unsicherheit abgebaut ist, das heißt, bis die Qualitätsverteilung durch Informationsaufnahme bekannt ist, hängt von der Komplexität des Produktes und den Gebrauchsgewohnheiten des Konsumenten ab. Außerdem kann beobachtet werden, daß der Abbau des wahrgenommenen Risikos von der Kauffrequenz des Produktes abhängig ist. Cox und Rich stellten fest, daß Produkte mit einer geringen Kauffrequenz eher mit einem größeren wahrgenommenen Risiko verbunden sind als solche mit einer hohen Kauffrequenz.[14]
In diesem Abschnitt wurde deutlich, wie eng die Erkenntnisse von Risikotheorie und Lerntheorie miteinander verknüpft sind. (siehe Kapitel: Gewöhnung und Erfahrung – Ergebnis und Determinanten des Lernprozesses)
[1] vgl.: Roselius, T., (1971)
[2] vgl.: Derbaix, C., (1983), S. 21
[3] Roselius, T., (1971), S. 61
[4] vgl.: Bauer, R. A., (1967)
[5] vgl.: Cunningham, S. M., (1967a)
[6] vgl.: Roselius, T., (1971), S. 58
[7] vgl.: Jacoby, J.; Szybillo, G. J.; Busato-Schach, J., (1977)
[8] vgl.: Hansen, F., (1972), S. 150
[9] vgl.: Hansen, F., (1972), S. 153
[10] vgl.: Bauer, R. A., (1967), S. 24
[11] vgl.: Sheth, J. N.; Venkatesan M., (1968)
[12] vgl.: Bettman, J. R., (1973)
[13] vgl.: Bettman, J. R., (1973)
[14] vgl.: Cox, D. F.; Rich, S., (1964)